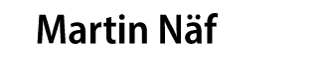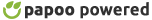blinder Reisender. « Die Welt ist auch hinter dem Sichtbaren gross»
Im Gespräch mit Andy Keller erzählt Martin Näf von seinen Reisen und davon, was er dabei erlebt und was ihn bei seiner Entdeckung fremder Welten besonders fasziniert. - Das Gespräch führte Andy Keller, GLOBETROTTER-MAGAZIN herbst 2012
Hier gibt's das Interview als PDF.
Vor ein paar Monaten schrieb ich dir eine E-Mail, um dich für einen Interviewtermin anzufragen. Nach nur einer Stunde kam deine Antwort aus Mauretanien in Afrika. Wie ist eine so schnelle Antwort möglich? Wie kannst du als Blinder E-Mails lesen?
Für Blinde gibt es sogenannte Bildschirmleseprogramme. Sie helfen bei der Navigation und sind mit einer Sprachausgabe oder einer Braille-Zeile gekoppelt. Mein Netbook hat mir deine E-Mail also ganz einfach vorgelesen.
Das tönt sehr hilfreich.
Das ist es auch. Natürlich gibt es Grenzen: Extrem überladene oder stark grafisch orientierte Webseiten etwa. Solche Grenzen gibt es für sehende Menschen ja auch, aber als blinder Computerbenützer spüre ich sie schneller.
Ich habe auch gestaunt, dass du mir aus Mauretanien geantwortet hast.
Ich sass gerade in der Hauptstadt Nouakchott im Büro des Mauretanischen Blindenverbands und hatte dort Internetzugang.
Was hast du in diesem unbekannten Teil Afrikas gemacht?
Auf meiner ersten richtigen Afrikareise vor zwei Jahren habe ich Kontakt mit dem Mauretanischen Blindenverband aufgenommen und danach einige der dortigen Mitglieder getroffen.
Welche afrikanischen Länder hast du auf jener ersten Reise sonst noch besucht?
Ich war mit dem Zug und der Fähre nach Marokko gereist. Dann ging es über Mauretanien weiter nach Mali und Burkina Faso. Eigentlich wollte ich in den Osten der demokratischen Republik Kongo, wo ich einen Freiwilligenjob an einer kleinen Uni gefunden hatte. Rückblickend eine verrückte Idee, die ganze Reise überland in drei Wochen zu machen! Schliesslich habe ich kapituliert und bin von Burkina Faso aus geflogen.
Es ist ziemlich ungewöhnlich, als Blinder allein in Afrika unterwegs zu sein.
Ja schon. Aber ich kann ja nicht den lieben Gott anrufen und ihn bitten, mach, dass ich etwas sehe, ich möchte gerne nach Afrika! Wenn ich etwas tun will, dann kann ichs nur als blinder Mensch tun, egal was es ist – es gibt mich nur in dieser Form.
Was ist deine Motivation, solche Reisen zu unternehmen?
Ich bin schon immer gerne gereist. Als Kind machten wir Campingferien in Korsika und Griechenland und fuhren zweimal nach Finnland. Später bin ich mehrmals mit dem Greyhound durch die USA getingelt. 1997 war ich sechs Monate dort. Dabei habe ich den Atlantik mit dem Containerschiff überquert – von La Spezia nach New York. Ein sehr eindrückliches Erlebnis. Auf dem Rückweg wollte ich segeln, ein Abenteuer, das auf den Bermudas leider ein vorzeitiges Ende fand. Der Skipper stellte mich wegen «Androhung von Meuterei» an Land. Ein Quatsch, aber es war nichts zu machen. -2004 reiste ich dann via die Türkei, Iran und Pakistan nach Indien. Damals war ich wieder beinahe ein halbes Jahr fort. Es war mein erstes Mal in einer ganz anderen Kultur und auch mein erstes Mal, wo ich mit einigen Einheimischen in wirklichen Kontakt gekommen bin.
Wie machst du so etwas als Blinder? Du reist ja ganz allein.
Die ersten zwei Wochen bis in die Osttürkei war ich mit einem deutschen Freund unterwegs. Dann hatte ich schon zu Hause versucht, via Internet irgendwelche Kontakte mit Pakistan zu knüpfen. Dabei war ich auf einen blinden Mann aus Islamabad gestossen, der mich sehr herzlich zu sich einlud und mir in Pakistan dann auch verschiedene weitere Kontakte vermittelte. In Indien war ich dann mehrere Wochen mit einem jungen Inder unterwegs. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ein blinder Mensch allein herumreist. Heute sind beide gute Freunde von mir. Im Übrigen ist man ja nie wirklich allein, vor allem wenn man wie ich meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.
Aber trotzdem: Wie findest du dich zurecht, wenn du an einem völlig unbekannten Ort ankommst?
Ich bitte jemanden, mir zu helfen. Oder ich steh einfach rum, bis jemand kommt und mich fragt, ob ich etwas brauche oder suche. Im Prinzip ist es ganz einfach. Es braucht bloss etwas Geduld und die Zuversicht, dass es schon irgendwie gehen wird. Dabei gibt es für mich zwischen dem Hauptbahnhof Zürich und einem Busbahnhof in Afrika oder Indien – was die Orientierung betrifft – eigentlich kaum einen Unterschied. Natürlich gibt es jetzt in all unseren Bahnhöfen diese Leitlinien für Blinde, doch wenn ich nicht weiss, wohin diese führen, dann nützen sie mir eigentlich nichts. Und ausserhalb der Bahnhöfe ist es damit dann sowieso vorbei. Da bleibt also nur die Hilfe der anderen Menschen,wenn ich den Weg nicht sehr gut auswendig kenne. Man könnte das System etwas lieblos «people surfing» nennen. Schwierig wird es, wenn ich mich sprachlich nicht verständigen kann, oder wenn keine anderen Menschen da sind. Wenn ich mich beispielsweise in einem Wald verirre oder wenn mich ein Bus an irgendeiner Landstrasse auslädt und entschwindet...
Was machst du dann?
Kommt darauf an. Wenn ein Auto vorbeifährt, versuche ich es anzuhalten, oder ich warte einfach und hoffe, dass irgendwann doch noch jemand kommt. Oder ich gehe mal los und schaue, was geschieht. Solche Situationen können nerven, aber sie können ja auch einem sehenden Menschen passieren. Das Erlebnis an sich ist nicht anders, nur dass ich mich als Blinder schon an Orten verirren kann, wo ein durchschnittlicher Mensch sich noch nicht verirrt. Dafür bekomme ich aber auch viel mehr und viel leichter Hilfe als ein «normaler» Reisender.
Gib mir ein Beispiel für spontane Hilfe.
Im Januar vor einem Jahr kam ich zum Beispiel abends um acht oder neun in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, an. Ich stieg aus dem Bus und hatte keine Ahnung, wo ich übernachten würde. Ich kann ja auch keine gedruckten Reiseführer mitnehmen, denn selbst wenn es sie in Blindenschrift gäbe: sie wären viel zu gross. Nach ein paar Minuten standen schon vier oder fünf Männer um mich herum und berieten, wo es wohl ein Hotel für 5000 CFA gibt. Einer der Männer war vermutlich der Buschauffeur, so ganz genau kann ich die vielen Stimmen nie unterscheiden. Schliesslich einigten sie sich auf ein Hotel, doch statt mich, wie es in der Schweiz geschehen würde, einfach dem nächsten Taxi zu übergeben, fuhren drei meiner Helfer mit mir zur Unterkunft. Sie wollten sehen, dass ich gut untergebracht war. Vielleicht wollten sie auch noch ein Trinkgeld, aber oft ist das zweitrangig. Ich muss in solchen Situationen bloss die Ungewissheit aushalten und mich von der vorübergehenden Hilflosigkeit nicht stressen lassen.
Was hat dich dazu gebracht, nach Afrika zu reisen?
Neben der Lust am Unterwegssein war es mein wachsendes Unbehagen am hiesigen Leben. Ich hatte schon seit einigen Jahren das Gefühl, hier in der Schweiz irgendwie nicht mehr weiterzukommen. Wir leben hier in einer unglaublich übersättigten Gesellschaft. Ich habe beispielsweise einige Jahre mit der Auswertung des Nachlasses von Paul und Edith Geheeb-Cassirer, den Gründern der Odenwaldschule und der Ecole d'Humanité auf dem Hasliberg, zugebracht. Das Ergebnis ist eine zweibändige Biografie. Das Projekt wurde vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert, und die beiden Bände erschienen bei einem bekannten deutschen Verlag. Es gab so gut wie keine Reaktion. Dabei sind es gute Bücher, aber der Markt ist schlicht übersättigt. Auch die Regale der Supermärkte sind überfüllt, und die Werbung drängt uns immer mehr völlig unnötige Dinge auf. Zugleich nimmt die Armut in Afrika und anderen Weltgegenden ständig zu, doch anstatt unseren Reichtum zu teilen, igeln wir uns ein: Wir verstärken die Kontrolle der europäischen Aussengrenzen; die Amerikaner bauen einen Zaun entlang der Grenze zu Mexiko. Das kann doch nicht sein. Als ich im Herbst 2010 zum ersten Mal nach Afrika aufbrach, war es deshalb nicht nur die übliche Reiselust, die mich trieb. Es war auch der Wunsch, irgendwie mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen und gebraucht zu werden und vielleicht etwas zur Überbrückung der Kluft beitragen zu können, die uns voneinander trennt.
Und, hat es funktioniert?
Einhundert Prozent ja! Die ersten vier Wochen in Marokko war ich zwar noch ein ziemlich gewöhnlicher Tourist. Doch dann,in Mauretanien und Burkina Faso und im Kongo, änderte sich dies völlig.
Was ist passiert?
In Mauretanien lernte ich Ousmane, einen 28-jährigen blinden Mann kennen, der mich zwei Wochen kreuz und quer durch Nouakchott geschleppt und mich überall vorgestellt hat, damit die Menschen dort begreifen, dass Blinde mehr können, als nur zu Hause zu sitzen oder zu betteln. Er wollte, dass ich den Menschen erzähle, dass ich ohne Begleitperson per Bahn und Bus von der Schweiz bis nach Nouakchott gereist war, dass ich einen Doktortitel habe und ein Experte in Schulfragen sei. Ousmane war als 14-Jähriger von zu Hause weggelaufen, weil er etwas lernen und arbeiten wollte, statt brav und gottergeben betteln zu gehen, wie es heute für behinderte Menschen in Afrika noch weitherum üblich ist und wie die Familie es wollte. Er sagte, die Menschen in Nouakchott müssten unbedingt Behinderte wie mich erleben, damit sich ihre Situation ändert. Ousmane habe ich in diesem Winter wieder besucht, weil ich irgendwie helfen will, seine schwierige materielle Lage zu verbessern.
Konntest du auch auf der weiteren Reise zur Überbrückung der Kluft beitragen?
Kurz nach meiner Begegnung mit Ousmane traf ich an der nigerischen Grenze, wo ich wegen Visumproblemen hängen geblieben war, Moussa. Der junge Mann arbeitete dort gegen Trinkgeld für die Zöllner und Polizisten. Er kümmerte sich den ganzen Nachmittag und Abend um mich, brachte mich zum Telefon, machte Tee für mich und brachte mir am Abend sogar eine Matte zum Schlafen. Irgendwann fragte er mich, ob ich nicht ein Kind brauche. Ich war zuerst etwas geschockt. Ich dachte an Kinderhandel. Doch dann begriff ich: Er bot mir eigentlich an, mich auf meiner weiteren Reise zu begleiten, wie damals der junge Mann in Indien. Nun, am Ende reisten wir zwei Wochen miteinander. Dabei erzählte er mir nächtelang von seiner Kindheit als Koranschüler und dem Leben und Überleben als ungelernter Arbeiter in Mali und Burkina Faso. Dazu half er mir als Dolmetscher in den Dörfern, wo die Menschen meist kein Französisch sprechen. Irgendwann fragte er mich, ob ich nicht sein Vater sein könne. Als ich Ende Januar abflog, um meine Volunteerstelle in Ostkongo anzutreten, gab ich ihm Geld, damit er sich einen Esel und einen Karren kaufen konnte, denn er hatte mir erklärt, dass er damit ein Stück aus seiner dauernden Armut herauskommen könne. Moussa hatte damals eine – noch nicht bezahlte! – Frau und ein fünf Monate altes Kind. Auch ihn habe ich in diesem Frühjahr wieder besucht, und ich werde Anfang Dezember wieder hinfahren.
Wie hast du ihn im Frühjahr angetroffen?
Er hat seit unserem Abschied in Ouagadougou unglaublich geschuftet. Seine Frau ist inzwischen abbezahlt. Er konnte sogar seinem Vater etwas Geld schicken und im Dorf ein Grundstück kaufen. Dort haben wir bei meinem jetzigen Besuch zusammen mit zwei seiner Schwäger ein Haus aus ungebrannten Lehmsteinen und eine lange Mauer zum Schutz vor den allgegenwärtigen und alles abfressenden Kühen, Schafen und Ziegen gebaut. Jetzt kann er auf diesem Grundstück pflanzen, und wenn die Regenzeit vorbei ist, kann er wieder als Transporteur arbeiten. Die Bauerei war für uns alle sehr lehrreich und spannend. Sie hat auch grossen Spass gemacht.
Und was war im Kongo?
Im Kongo habe ich Psychologie und Englisch unterrichtet. 30 Studierende zwischen 19 und 60 Jahren an einer ganz neuen Uni in Uvira in Süd-Kivu. Nach zwei Monaten fragten mich die Gründer, ob ich nicht Rektor der Uni werden wolle. Es war unglaublich. Total spannend, denn ich bin von meiner Ausbildung her ja Pädagoge. Wir führten sofort eine wöchentliche Universammlung und ein paar studentische Arbeitsgruppen ein. Leider stellte ich irgendwann fest, dass der Unigründer nebenher Bischof einer zum Teil von den USA gesponserten evangelikalen Kirche war. Ich habe versucht, die Sache mit ihm zu klären, doch er hat nicht verstanden, weshalb er nicht gleichzeitig Gründer und Vizerektor einer humanistisch liberalen Uni und fundamentalistischer Bischof sein kann. Damit war die Sache für mich gestorben, und ich habe mich aus der Uni zurückgezogen. Es tut noch heute weh. Das Projekt war wie eine grosse Liebe!
Bist du seit der Geburt blind?
Nein, ich kam sehbehindert zur Welt und erblindete dann mit zwölf Jahren ganz. Ich wurde in die normale Primarschule eingeteilt, denn ich sah damals noch genug, um Lesen und Schreiben zu lernen. Dann kam ich ins Gymnasium. Dass ich auch nach dem Erblinden in der normalen Schule bleiben konnte, verdanke ich der tollen Haltung meiner Eltern und der Offenheit meiner Lehrer. Geholfen hat aber sicher auch, dass mein Vater damals Schulpsychologe in Basel und nicht irgendein Magaziner bei der Migros war.
Erinnerst du dich noch an Bilder oder Farben?
Ich kann mich an Sonnenuntergänge, Landschaften und den Himmel erinnern. Diese Erinnerungen spielen für mich aber keine grosse Rolle. Es ist etwa so, wie wenn du bis zu deinem 12. Lebensjahr in einem Andendorf gelebt hast, seither jedoch nie mehr dort warst. Die Bilder und Erlebnisse sind weit weg, begraben unter allem, was seither war und jetzt ist.
Wie ging es nach der Matur weiter?
Ich habe studiert, zum Teil in den USA, zum grösseren Teil in der Schweiz: Pädagogik, Psychologie, auch ein wenig Heilpädagogik, Geschichte, Englisch und Politologie. Meine erste Berufstätigkeit war Lehrer und Erzieher an der Ecole d'Humanité auf dem Hasliberg im Berner Oberland. Das war eine ganz wichtige Zeit für mich. In erster Linie war es der Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen, der spontan, offen, unkompli- Die Geschichten der Menschen, denen ich begegne, sind für mich das Wichtigste.
Kompliziert war – dies auch im Umgang mit mir als Blindem. Danach habe ich an verschiedenen Orten als Lehrer und Erwachsenenbildner gearbeitet. Dabei wurde ich zu einem immer radikaleren Kritiker unseres herkömmlichen Bildungswesens. Ich begann mich mit sogenannten Alternativschulen zu befassen und schrieb Ende der 1980er-Jahre ein Buch über diese Szene.
Wie nimmst du das Unterwegssein auf Reisen wahr?
Es kommt auf die Art des Unterwegsseins an. In modernen Bussen oder Zügen mit klimatisierten Wagen nehme ich so gut wie nichts von der Welt draussen wahr. Gelegentlich frage ich Mitreisende, was es draussen zu sehen gibt, doch vor allem, wenn ich in mir fremden Ländern unterwegs bin, taugen Beschreibungen wenig. In der Schweiz bin ich ja Hunderte Male über irgendwelche Wiesen und durch Wälder gegangen, war auf Schneefeldern und in felsigen Bergflanken. Hier weiss ich ungefähr, was ein Wald oder eine Küche ist und wie eine Metzgerei oder ein Markt aussieht. Aber in Indien oder im Niger muss ich mir all diese Bilder neu erarbeiten. Das ist ein langsamer Prozess. Ich muss dazu viel zu Fuss unterwegs sein, in engem körperlichen Kontakt mit der Welt, um sie unter meinen Füssen oder auf meiner Haut zu spüren, um ihre Geräusche und Gerüche kennenzulernen. Und ich muss die Dinge um mich herum vor allem immer wieder anfassen, um eine konkrete Vorstellung davon zu bekommen, was mich umgibt. Im Wort «begreifen» steckt ja auch das Anfassen – der direkteste Bezug zur Welt. Dabei lassen sich kleine, handliche Dinge leicht begreifen, aber wenn ich zum Beispiel begreifen will, wie man im indischen Dorf kocht oder wie die Landschaft im Niger aussieht, wird die Sache extrem aufwendig. Da bin ich sehenden Menschen natürlich hoffnungslos unterlegen. Das ist ein wirklich schwieriger Punkt, dieser dauernde Vergleich mit «den Anderen», vor allem weil Reisen so oft gleichgesetzt wird mit Sehen.
Interessierst du dich beim Reisen für sogenannte Sehenswürdigkeiten?
Ja und nein. In Isfahan, im Iran, war ich beispielsweise einmal mit einem Einheimischen unterwegs. Wir liefen durch den historischen Teil der Stadt auf die offensichtlich wunderbaren islamischen Bauwerke zu. Ich spürte eine friedliche Atmosphäre und fragte meinen Begleiter, wie die Gebäude aussehen. Er antwortete «it's very beautiful». So ging das zwei Stunden lang bei jeder weiteren Frage von mir: «It's nice» und «it's beautiful». Er war nicht in der Lage, mir die offenbare Schönheit dieser Stadt zu beschreiben. Interessant ist ja die Frage, was das Besondere ist, das eine Sehenswürdigkeit ausmacht. Das Optische? Die Ambiance? Die Begegnungen? So gesehen, ist das innere Erlebnis das Wesentliche, und da habe ich je nachdem sogar mehr von einer Sehenswürdigkeit, wenn mir ein guter Freund zu Hause davon erzählt, als wenn ich mühsam versuche, mir mit meinen Mitteln ein Bild davon zu machen. Was mir am Reisen wirklich gefällt und was mich fasziniert, ist das Draussensein, das Unterwegssein, die Atmosphäre, wenn ich bei irgend einem Strassenverkäufer in Kolkata oder Niamey auf einer Holzbank sitze und einen Teller Nudeln esse, oder auf einem Lastwagen über eine afrikanische Piste rumple, und – als Wichtigstes – die Geschichten der Menschen, denen ich begegne, das, was sie mir über ihre Hoffnungen und Ängste, ihr Land und ihre Gebräuche erzählen. Es ist eine grosse Welt hinter der Welt des Sichtbaren. Um diese Welt zu entdecken, brauche ich keine Augen, ja manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass mir meine Blindheit dabei eher hilft, als dass sie mich behindert.
Vor zwei Jahren hast du ein ziemlich verrücktes Experiment gemacht. Du bist allein auf dem Jurahöhenweg von Basel nach Genf gewandert. Wie ist eine solche Wanderung als Blinder möglich?
(Lacht) Ich habe es nicht bis nach Genf geschafft. Im Val de Travers habe ich nach acht Tagen abgebrochen. Ich hatte schon lange den Traum, diesen Weg einmal zu gehen, aber ich dachte immer, dass ich es mit einem sehenden Begleiter oder einer Begleiterin machen würde. Im Sommer 2010 hörte ich dann von einem sprachgesteuerten Navigationsgerät. Ich probierte es in der Gegend von Basel aus, und es funktionierte einigermassen. Und dann hatte ich plötzlich die Idee, allein nach Genf aufzubrechen! Ich war völlig fasziniert, aber auch total nervös – viel mehr als bei all den anderen grossen Reisen!
Konntest du dich mit diesem Gerät tatsächlich orientieren?
Ja und nein. Es kennt leider auch im Fussgängermodus keine Wanderwege. Ich bin deshalb oft auf kleinen Strassen von Dorf zu Dorf gewandert. Ich hatte auch noch einen gewöhnlichen, tastbaren Kompass dabei. Aber die wichtigste Hilfe waren die Sonne und die Menschen, die ich unterwegs nach dem Weg fragte. Trotz allem verirrte ich mich natürlich immer wieder, aber es ging eigentlich viel besser, als ich gedacht hatte. Ich war täglich zwischen zehn und zwölf Stunden unterwegs. Abends stellte ich irgendwo mein Zelt auf.
Warum hast du die Wanderung abgebrochen?
Das Wetter wurde schlechter, und ich hatte allmählich auch genug von dem Experiment. Dass ich mich immer wieder verirrte, war okay. Das gehört dazu. Doch ich kann Wege, die über eine Weide führen, mit meinem Stock nicht wirklich ertasten. Und auch die eigentlichen Bergwege sind zu schwierig für mich. Ich spüre die diversen Hindernisse mit meinem Stock zwar sehr gut. Aber die auf irgendwelche Steine gepinselten Markierungen spüre ich natürlich nicht, sodass ich sehr leicht vom Weg abkomme. Auf Bergwegen kann das sehr gefährlich sein, und darauf hatte ich keine Lust. Ich wusste, ich würde nach Genf kommen, aber nicht auf dem eigentlichen Höhenweg. Immerhin: Laut meinem GPS war ich rund 200 Kilometer von Basel entfernt. Ich war sehr stolz und zufrieden, als ich zurückfuhr: acht prächtige, sonnige Tage und ein grosses Gefühl von Freiheit.
Stellst du dir manchmal vor, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du nicht blind geworden wärst?
Ich denke, dass mich meine Blindheit vor der Versuchung geschützt hat, ein «ganz normales» Leben zu führen. Ich muss und musste mich vielleicht öfter als andere mit der Frage auseinandersetzen, was für mich möglich ist und wie ich zu meinem Ziel komme. Ich kann und konnte nicht einfach auf das zurückgreifen, was «man» so tut. Das Leben wird dadurch vielleicht etwas anstrengender, aber auch sehr reizvoll.
interview Engagement und Vorträge
Martin Näf ist Autor, Erziehungswissenschaftler, Schulkritiker und Quereinsteiger in Sachen Ent- wicklungszusammenarbeit. Seit Anfang dieses Jahres ist er Präsident des von ihm mitgegründeten Vereins «DarsiLaMano». Er finanziert seine Reisen und die im Rahmen dieses Vereins unterstützten Projekte zum Teil durch Vorträge über seine Erlebnisse als blinder Reisender: «Abenteuer Welt – unterwegs mit dem weissen Stock».
Kontaktaufnahme und weitere Infos:
m.naef@martinnaef.ch
www.darsilamano.org
© Globetrotter Club, Bern